Medizindaten-Konferenz: Über geeignete Garantien, Desiderate und Haftungsfragen
KI-Modelle brauchen für das Training viele Daten. Die Direktoren des Zentrums für medizinische Datennutzbarkeit sprachen dazu über mögliche Chancen und Risiken.
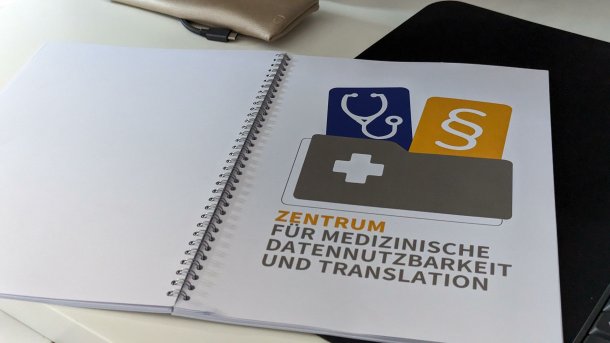
(Bild: heise online)
Das kürzlich eröffnete Zentrum für Medizinische Datennutzbarkeit und Translation (ZMDT) der Universität Bonn versteht sich als Treiber von Datenschutz und -nutzbarkeit in der Medizin im Interesse des Gemeinwohls. Wie die Co-Direktorin des ZMDT, Prof. Louisa Specht-Riemenschneider bei der Eröffnung betonte, geht es vor allem darum, die Möglichkeiten der Datenschutzgrundverordnung und anderer Gesetze wie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz und bald auch den europäischen Gesundheitsdatenraum aufzuzeigen und Forschung sowie eine bessere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Dabei stünden sich Datenschutz und Datennutzbarkeit nicht unvereinbar gegenüber. Laut Specht-Riemenschneider verhindern in den wenigsten Fällen Juristen die Datennutzung. In der noch relativ jungen DSGVO ist auch ein Forschungsprivileg verankert. Specht-Riemenschneider warb dafür, dass sich Mediziner, Juristen und weitere Beteiligte austauschen und miteinander reden, um Forschungsvorhaben zu realisieren. Dies sei auch das übergeordnete Ziel des ZMDT. Häufig würden praktische Anwendungsbeispiele fehlen, so Specht-Riemenschneider.
Hohes Schutzniveau ermöglichen
Dabei gäbe es verschiedene Möglichkeiten, Daten zu nutzen. Zum einen gibt es die, die zu Forschungszwecken bereits erhoben wurden, dann die Versorgungsdaten und dann auch Daten, die temporär zusammengeführt werden. "Wir benötigen große Datenbestände, um KI trainieren zu können. Das bedeutet nicht, dass große Persönlichkeitsprofile erstellt werden sollen. Die Mediziner interessieren sich nicht für die Identität hinter den Daten", sagte Specht-Riemenschneider. Diese großen Datenbestände würden zu besseren Therapiemöglichkeiten führen. "Wenn wir das datenschutzkonform umsetzen können, unter Einbeziehung der Patienten, dann ist viel gewonnen". Die Patienten müssten allerdings mitgenommen und ein "hohes Schutzniveau" ermöglicht werden, so Specht-Riemenschneider.
Nach der ZMDT-Direktorin gilt es vor allem, die Fragen zu beantworten, wie man an die Daten kommt, was man mit diesen tun darf und welche Instrumente für Rechtssicherheit sorgen. Um an Daten zu gelangen, können Betroffene gefragt werden. Dazu wurde beispielsweise auch der Broad Consent beschlossen, bei dem Probanden informiert der Datennutzung zustimmen können, ohne immer wieder gefragt zu werden. Der Beschluss ist umstritten, Kritiker sehen darin eine Möglichkeit, die DSGVO auszuhöhlen. In Arbeit ist derzeit ein Pilotprojekt in Krebszentren aus Deutschland und den USA, die dahingehend einen standardisierten, DSGVO-konformen Datenfluss entwickeln wollen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, Daten bei Dritten zu erwerben. Dabei ginge es allerdings nicht um das ebenfalls umstrittene Dateneigentum, das Specht-Riemenschneider als tot gerittenes Pferd bezeichnete und bekräftigte: "Es gibt kein Dateneigentum und es wird vermutlich auch kein Dateneigentum geben".
Es kommt auf die Zweckbestimmung an
Wichtig ist laut Specht-Riemenschneider die Zweckbestimmung der Daten. Wer künftig Daten beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit anfragen will, muss im entsprechenden Antrag ebenfalls erklären, für welchen Zweck die Daten genutzt werden. Im Fall von bereits vorhandenen Daten sei auch eine Interessenabwägung nötig. Bei all den Vorhaben würde das Gesundheitsdatennutzungsgesetz zwar helfen, aber nicht alle Probleme lösen. Specht-Riemenschneider sieht jedoch weiterhin Rechtsunsicherheit – oft müsse abgewogen werden, wie Interessen auf welche Weise miteinander kollidieren.
Es sei auch möglich, Daten zu KI-Trainingszwecken zusammenzuführen. "Auch das ist nach den Vorgaben der DSGVO als Weiterverarbeitung mit geeigneten Garantien möglich", so Specht-Riemenschneider. Dazu gibt es beispielsweise Datentreuhänder, Datenaltruismus und auch die von Wissenschaftlern entwickelten Five Safes. Dazu hat der Rat für Informationsinfrastrukturen verschiedene Arbeiten veröffentlicht.
Rasante Entwicklungen im Bereich KI
Auch der Co-Direktor des ZMDT Prof. Alexander Radbruch, der auch Radiologe am Universitätsklinikum Bonn ist, sprach sich für eine bessere Datennutzung aus. Die neuesten Entwicklungen wie die Video-KI Sora würden beeindruckend die Möglichkeiten von KI zeigen, bei der Radiologie sei der Prozess genau umgekehrt, dort werden Bilder mithilfe von maschinellem Lernen auf Unregelmäßigkeiten untersucht. Inzwischen, so Radbruch, seien neuronale Netzwerke besser zur Erkennung und Ausmessung von Tumoren geeignet, kostengünstiger und effizienter. Auch ließen sich Krankheitsverläufe besser mit KI auswerten.
Bereits 2016 hatte Prof. Geoffrey Hinton, der als KI-Urgestein bezeichnet wird, auf einer Konferenz dazu aufgerufen, keine Radiologen mehr auszubilden. Facebook und die NYU School of Medicine starteten 2018 das Forschungsprojekt fastMRI, bei der KI helfen soll, MRT-Scans für mehr Menschen nutzbar zu machen. Google und weitere große Tech-Unternehmen versuchen ebenfalls, KI im Gesundheitsbereich zugänglich zu machen und können dadurch viele Daten sammeln.
Patienten würden länger als notwendig im Krankenhaus liegen, weil sie nicht zeitnah an MRT-Untersuchungen teilnehmen können, das ließe sich Radbruch zufolge stark beschleunigen. Auch die Gabe von Kontrastmitteln ließe sich verringern, da sich mittels KI Signale verstärken lassen.
MRT bei ALDI und Co.
Künftig könnten MRTs bei Aldi, Walmart und Co. stehen, träumt Radbruch, sofern kein Kontrastmittel verabreicht werden müsse. KI-Tools würden in allen Bereichen immer zugänglicher. Im Notarztwagen bei Schlaganfällen könnte das Ultra-Low-Field-MRT helfen, das deutlich günstiger, kleiner und damit portierbarer ist als ein herkömmliches MRT und mit einer normalen Steckdose betrieben werden kann, wie aus verschiedenen in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Fachartikeln hervorgeht.
KI besser als übermüdeter Assistenzarzt
In naher Zukunft sei es unwahrscheinlich, dass Radiologen ersetzt werden, so Radbruch, aber "KI steht auch am Anfang", zudem gebe es viele regulatorische Umsetzungsprobleme. Er warf auch die Frage auf, ob eine KI als Entscheidungshilfe in der Diagnostik nicht hilfreicher sei als ein übermüdeter Assistenzarzt. In jedem Fall brauche es jemanden, der die Verantwortung bei der Diagnose übernimmt. Irgendwann würde KI zum Standard werden. Wenn beim Blutanalysegerät etwas schiefläuft, "gibt es auch eine Gerätehaftung", sagte Radbruch. Das könne "komplett neue Fragen" aufwerfen.
Das ZMDT wird von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, der Medizinischen Fakultät, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie dem Exzellenzcluster ECONtribute: Märkte und Public Policy der Universitäten Bonn und zu Köln getragen.
(mack)